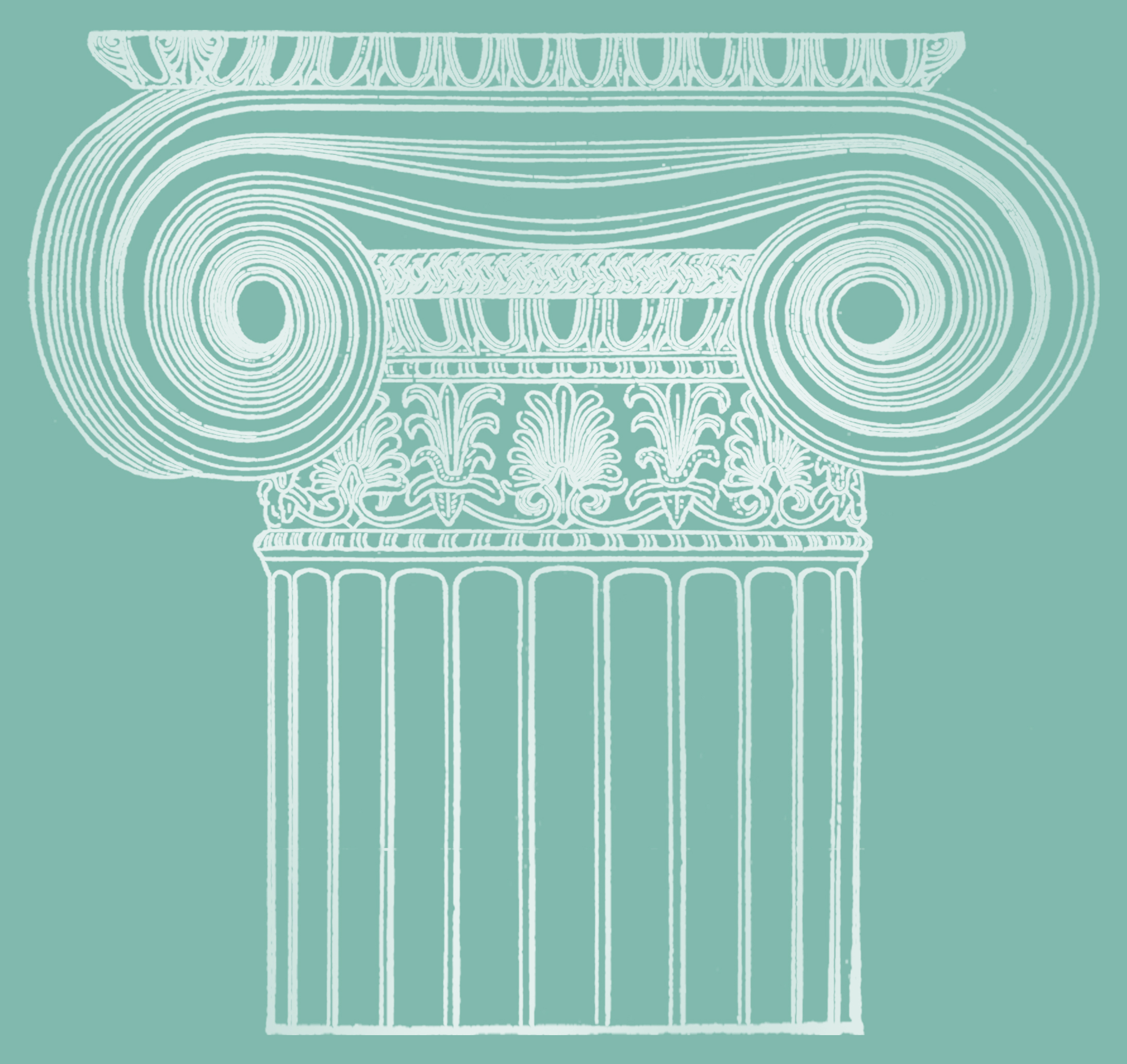VENEDIG 2018
Quo vadis architecturae?
Die Architekturbiennale 2018 in Venedig als Denksportaufgabe
Das Manifest der beiden Kuratorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara (Grafton Architects aus Dublin) zum Thema „Freespace“ war schon lange bekannt, man hätte es jederzeit lesen können, dann wäre man vielleicht nicht so überrascht gewesen, angesichts dieser Architekturbiennale. Der doch für manche recht ungenaue, wolkige Begriff des „Freespace“ (Motto der Biennale 2018) wird darin erklärt. Humanistische Wertvorstellungen und große Begriffe sind darin zu finden: Von der Freigebigkeit des Geistes und dem Sinn für Menschlichkeit als Grundlage der Architektur liest man da; ein unprogrammierter freier Raum, ein demokratischer Raum soll er sein, die Möglichkeit der Gaben der Natur (Licht, Sonne, Luft etc.) nutzen und vieles mehr. Und so wurde es eine „leise“ Biennale, ohne marktschreierische Projekte, ohne besondere Highlights, ein Event, dass zwar zum Nachdenken anregt, aber auch vieles offen lässt.
Die Ideen, Gedanken und Vorgaben der Architektinnen waren sicher hochgesteckt. Freespace ist kein einfacher Begriff, er beinhaltet vieles und er lässt auch Raum für Interpretationen. Freespace ist – um mit den Worten von Ralf Moneo zu sprechen – nicht mit Common Space und Public Space zu verwechseln. Freespace geht – so auch das Manifest – weit darüber hinaus. „Free Space“ kann auch als Art eines kategorischen Imperativs gedeutet werden. Wenn es nun einigen Teilnehmern, ArchitektInnen etc. nicht gelungen ist, den Erwartungen zu entsprechen, liegt das nicht nur an der Vieldeutigkeit des Wortes. Es liegt auch an unserer Zeit, in der jeder immer nur die Steigerung, das Übertreffen des schon Dagewesenen erwartet, fast verlangt. Vor zwei Jahren – Alejandro Avarena – was kommt danach? Kann man die konzeptuelle Revolution, die er angestoßen hat (Reporting from the Front) noch toppen? Ist das überhaupt not, oder ist ein bescheidener Beitrag auch zu akzeptieren? Das zwangsläufig Neue ist nicht immer auch das Bessere. Aber vielleicht liegt es vielleicht auch an dem was Sean Griffiths (Professor, Architekt an mehreren internationalen Architekturuniversitäten) formuliert hat. Er stellt die Zukunft des Architektenberufes, so wie er heute abläuft, überhaupt in Frage. Er meint, dass man für den scheußlichen kastelförmigen Rasterwohn- und sonstigen -bauten eigentlich keine Architekten mehr braucht. Die Funktion des Architekten kann doch nicht auf die Farbgebung von Markisen und die Auswahl von Türgriffen beschränkt sein. Das Fortdenken der Hypothese von Griffiths kann in verschiedene Szenarien führen: In eine dystopische Welt in der Maschinen die Bauten für den Menschen errichten. Oder zur Architektur, die aus und in der Natur wie von selbst entsteht und so wie Baruch Spinoza „Gott in der Welt treffen“ will. Ganz in diesem Sinne ist die Aussage von Griffiths zu verstehen, wenn er meint, dass die Zeit der Stararchitekten endgültig abgelaufen ist. Gotische Dome und die sogenannte „volkstümliche“ Architektur haben auch nie (Star)Architekten gebraucht. Leider haben das noch nicht alle realisiert und es gab wieder ein Menge von Selbstdarstellungen und Egotrips auf der Biennale. Andere Teilnehmer wiederum erschöpften sich in Theorie, Wände vollgepickt mit Notizen, Philosophie und Konstrukten. Das ist auch OK, denn die Grafton Architects haben ausdrücklich von „built and unbuilt“ gesprochen. Auffallend ist jedenfalls die Ausführung der gezeigten (sofern nicht nur Pläne und Filme zu sehen waren) Modelle: meist aus Holz oder anderen „sustainablen“ Baustoffen und von einer hervorragenden, handwerklichen Qualität. Die ganze Biennale duftete nach Pinienharz, geräuchertem Bambus, Lehm, Erde und Natur. Scheinbar hat Zumthor mit seiner Aussage von vor zwei Jahren doch recht behalten.
Man erkämpft sich nun zwischen Selfis machenden JapanerInnen (die ansonsten gar nicht bemerken, dass sie in Venedig sind weil sie nur in ihre Handys starren), weiße Hüte samt schwarzen Hutbändern tragende, schwarz behemdeten Architekten den Eintritt in die 317 Meter lange Cordiere, die ursprüngliche Seilmacherei der venzianischen Schiffswerften. So man nicht gerade von einem Handystick getroffen wird, ist hier, ganz zu Beginn gleich das Manifest der beiden Architektinnen wie ein Faustschlag spürbar: Ein Vorhang aus Hanfseilen bildet den Eingang und erinnert an den ursprünglichen Sinne dieses Raumes. Er befreit ihn von gewohnten Sehweisen und macht neugierig auf das Kommende. Dieser Vorhang als Zitat der ursprünglichen Funktion entzieht der Halle ihre seit Jahren eingeschriebene Funktion als Ausstellungsraum und bringt den Ursprung zurück. Im Dunkel des nächsten Raumes, gleich dahinter werden Grundrisse, Schnitte, Schiffszeichnungen, Konstruktionspläne weiß überblendend an die Wände projiziert, sie erinnern an Zeit, Geschichte,Kultur, Verlust und Erfolg und das „Vergehen“ der Dinge. An dieser Installation müssten oder sollten sich alle weiteren Projekte und Darstellungen eigentlich eine Richtschnur nehmen. Wenige haben das geschafft, aber ein herausragendes Projekt, und zwar gleich das Erste in der langen Halle war „A School in the Making“ der indischen Architekten Case Design aus Mumbai. Hier war eine größt- und bestmögliche Umsetzung des Manifestes zu erkennen. Optische Täuschungen mit Raumspielen, Projektionen und Leerräume sind auch im Arsenale zu finden, auch ein bewusst als Leerraum konzipierter kreisförmiger, „digitaler“ Freespace den kaum jemand benutzte – die Menschen waren viel zu hektisch. Hinter der Cordiere, bei den Länderausstellungen gab es einige aufregende Momente, bis sich nach dem „ahh“ und „ohh“ die reale Wirkung der Bilder als (reine) Show entpuppte. Eine scheinbar endlose Struktur in einem runden, horizontlosen weißen Raum mit Tonkulisse war irritierend und regte zum Taumeln an, bogenförmig abgehängte Papierbahnen mit einem schmalen Durchgangsspalt, Wasserspiele und Rauchkulissen, Videoprojektionen usw. Es wurde generell wieder von allen Teilnehmern sehr viel Wert auf Design und Gestaltung gelegt, nicht wie vor 2 Jahren, wo auch improvisiert werden durfte. Der Preis der Biennale, der goldene Löwe für den besten Länderpavillon auf den Gardinis ging diesmal an die Schweiz. Sie hatte sich, als einer der wenigen Länder, eines der vor der Biennale genannten Schwerpunkte – des Wohnbaus angenommen und dabei auch versucht, den Freespace wenigstens zu streifen. Und zwar mit dem typischen „Schweizer Humor“. Die Kuratoren, vier wissenschaftliche Mitarbeiter der ETH Zürich bauten in den Pavillon eine „leere“ Wohnung ein. Leer ist nicht ganz richtig, die Räume sind zwar leer aber mit allen, zum Wohnen notwendigen Strukturen wie Türen, Fenster, Einbaukästen, Beschlägen, Steckdosen und Schalter ausgestattet. Ein Parkettboden mit weißen Sockelleisten, weiße Wände und Decken ziehen sich durch die verwinkelten Raumanordnungen – das ist aber auch schon alles. Eher langweilig würde der Nutzer auf den ersten Blick sagen. Richtig, aber vom Hasenstall bis zur Behausung für einen Giganten kann man in dieser „Wohnung“ alles finden. Die Maßstäbe verwischen sich, Türklinken in 1,80 Meter Höhe inklusive einer 2,40 Meter hohen Türe, winzige Fenster in 1,60 Meter hohen Räumen, auch die Elektroinstallationen sind Sonderanfertigungen und dem verrückten Maßstab der einzelnen Zimmer angepasst. Was soll das bedeuten? Einerseits kann man es als kritische Auseinandersetzung mit dem heute üblichen Wohnbau verstehen. Einheitsgestaltung ade! Andererseits als Hinweis auf die wirklichen Bedürfnisse der Menschen, müssen Wohnungen dem Smart-Gedanken, der Effizienzsteigerung, der Maximierung oder Minimierung von Nutzungen folgen? Beim Eintreten in den Pavillon erlebt man jedenfalls eine Deutung des Freespace. Jeder kann sich hier einrichten, wie er will. Links von der Türe schrumpft alles auf Zwergengröße zusammen, rechts werden die Elemente immer größer, bis sie den maximalen Stand von 2,4 Meter erreichen. Diese Deckenhöhe widerspricht auch allen gängigen Ordnungen, sogar im Wiener Sozialbau sind die Räume 2.45 Meter hoch. Dem entsprechend ist auch der Titel „Svizzera 240: House Tour“ zu verstehen. Vielleicht ist der Beitrag aber auch eine versteckte Kritik am von Grafton Architects gewählten Titel Freespace? Eine spezielle Erwähnung bei den Länderpavillons erhielt auch England. Die Kuratoren ließen die Räume im Pavillon völlig leer, komplett ausgeräumt. Auf einem Baugerüst kann man außen vorbei auf das Dach gelangen, hier ist eine große Terrasse auf der man (typisch englisch) Tee trinken und in die Gegend schauen kann – sonst nichts. Der Beitrag nennt sich „Island“, was bei einigen Besuchern zu Verwirrungen und Verwechslungen mit einem „möglichen“ isländischen Beitrag führte. Island (Insel) ist jedoch als kritische Äußerung zum Brexit zu deuten, wo führt der hin? Auch in einen Freespace? Es bleibt aber abschließend festzustellen, dass in den architektonischen Projekten der (Zeit)Raum zwischen der Materialisierung und der Theorie, der Raum der Produktion und der Prozess – den Aravena vor zwei Jahren angerissen/begonnen hatte – in den diesjährigen Beiträgen unbearbeitet und meist auch ausgespart bleibt. Oder wird er bereits von Maschinen erledigt, wie im Parametrismus? Es scheint, als ob die Architektur nun wirklich am Ende angelangt ist, dass der Beruf des Architekten „going underground“ ist.